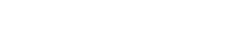Hauptspalte
Pressemeldungen
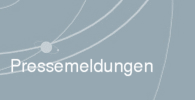
Nummer: 2012/096 vom 12.04.2012
Bereich: Forschung
Sachgebiet: Physik
Physiker aus Leipzig und Lviv starten Institutspartnerschaft
Physiker der Universität Leipzig haben Anfang April dieses Jahres eine
neue, von der Alexander-von-Humboldt Stiftung geförderte
Institutspartnerschaft mit dem Institute of Condensed Matter Physics
der National Academy of Sciences of Ukraine in Lviv gestartet.
Verantwortlich für das Projekt ist auf Leipziger Seite Prof. Dr.
Wolfhard Janke, der Leiter der Arbeitsgruppe "Computerorientierte
Quantenfeldtheorie" des Instituts für Theoretische Physik. Durch die
neu eingerichtete Institutspartnerschaft werden ukrainische
Wissenschaftler in den nächsten drei Jahren regelmäßig für mehrere
Monate an der Universität Leipzig zu Gast sein.
Partnerin auf ukrainischer Seite ist Dr. Viktoria Blavatska, die 2007
mit einem Humboldt-Fellowship ein Jahr an der Alma mater geforscht hat
und anschließend mehrmals für längere Forschungsaufenthalte in Leipzig
zu Gast war. Diese vorausgegangene Förderung ist eine Voraussetzung, um
im Alumni-Programm der Alexander-von-Humboldt Stiftung eine
Institutspartnerschaft beantragen zu können, wie Prof. Janke erklärte.
Die Alexander-von-Humboldt Stiftung lege großen Wert auf die
Nachwuchsförderung. Dies werde seinen Doktoranden und
wissenschaftlichen Mitarbeitern regelmäßige Arbeitsaufenthalte in Lviv
ermöglichen, sagte er weiter. Darüber hinaus umfasse die Förderung auch
die finanzielle Unterstützung von Workshops und kleineren Konferenzen,
die zweimal jährlich im Wechsel in Lviv und Leipzig stattfinden werden.
Inhaltlich befasst sich das gemeinsame Projekt mit Polymeren in
ungeordneten Materialien, die von porösen Gesteinsschichten bis hin zu
komplexen biologischen Zellen reichen können, in denen andere Moleküle
zufällig verteilte Hindernisse darstellen (sogenannte "crowded cells").
Aufbauend auf vorbereitende Arbeiten der Wissenschaftler der
Universität Leipzig, die bereits zu zahlreichen gemeinsamen
Veröffentlichungen mit dem Institut in Lviv geführt haben, sollen jetzt
auch Situationen betrachtet werden, bei denen die Unordnungsstärke
nicht rein zufällig verteilt ist, sondern bestimmten räumlichen Mustern
folgt. Außerdem sollen die Untersuchungen auf eine Klasse von Polymeren
verallgemeinert werden, deren intramolekularen Kräfte langgestreckte
Anordnungen favorisieren. Dieser sogenannte "semiflexible" Fall spielt
unter anderem für Anwendungen in der Biophysik eine zentrale Rolle. Ein
wichtiges Beispiel sind Proteine, bei denen verschiedene Aminosäuren zu
einem linienförmigen Polymer aneinander gekettet sind. Konkret soll
beispielsweise das Adsorptionsverhalten von Polymeren an Oberflächen
mit geometrischen Mustern studiert werden, die typischerweise keine
ganzzahlige Dimensionalität und einen hohen Grad von Selbstähnlichkeit
aufweisen (sogenannte "Fraktale").
Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Muster aus mehreren
verkleinerten Kopien seiner selbst besteht. Methodisch ist dabei an
eine Kombination von theoretischen Berechnungen mit Papier und
Bleistift und Simulationen auf leistungsfähigen Computern gedacht,
wobei die Leipziger Wissenschaftler vor allem ihre langjährige
Erfahrung mit hochoptimierten sogenannten
"Monte-Carlo"-Simulationsverfahren einbringen können. Ein zweiter
größerer Themenkomplex beschäftigt sich mit geladenen Polymeren, bei
denen über große Abstände wirkende elektrostatische Kräfte eine
wichtige Rolle spielen. Gegen Ende des Projekts sollen auch einfache
Modelle für kurze Proteine (sogenannte Petide) betrachtet werden, für
die in Leipzig ebenfalls bereits umfangreiche Vorarbeiten vorliegen.
Prof. Janke betont, dass diese Institutspartnerschaft bereits
bestehende Forschungsverbünde der Universität Leipzig im Rahmen der
Graduiertenschule BuildMoNa, des deutsch-französischen
Graduiertenkollegs mit der Unversité Nancy, der sächsischen
Forschergruppe FOR877 und des erst kürzlich eingerichteten
Sonderforschungsbereichs SFB/TRR102 mit der Universität Halle ergänzt.
"Ich erhoffe mir von der bevorstehende Zusammenarbeit mit den
Wissenschaftlern aus Lviv wertvolle Impulse für neue Fragestellungen",
sagte er.